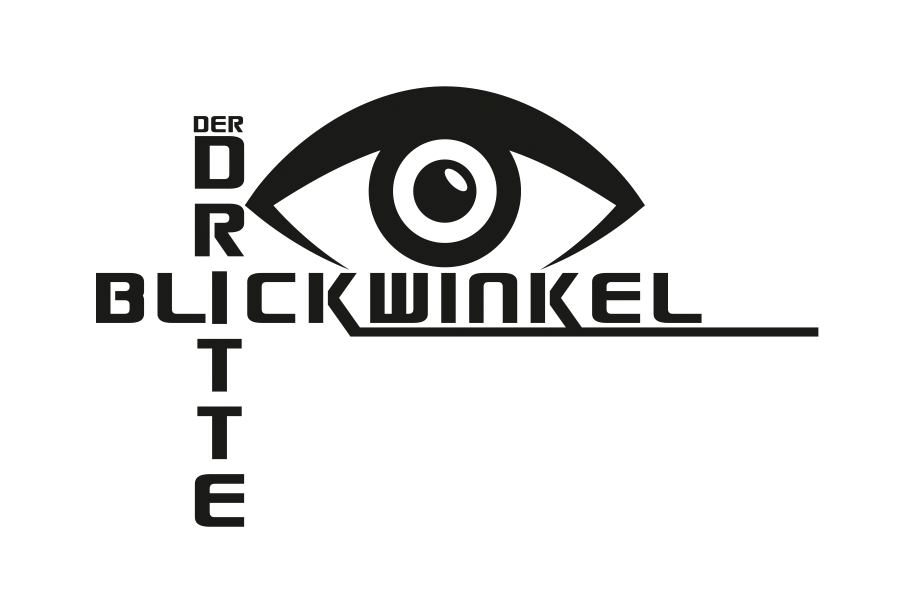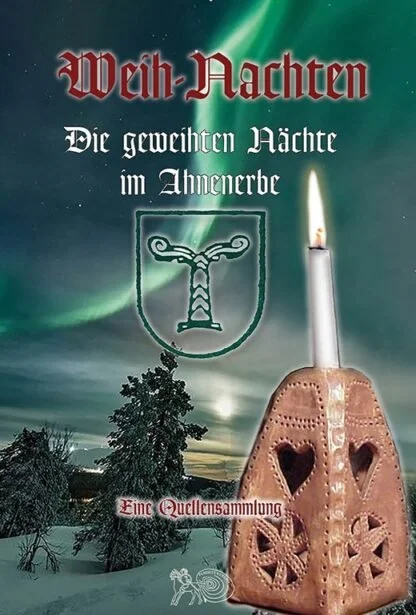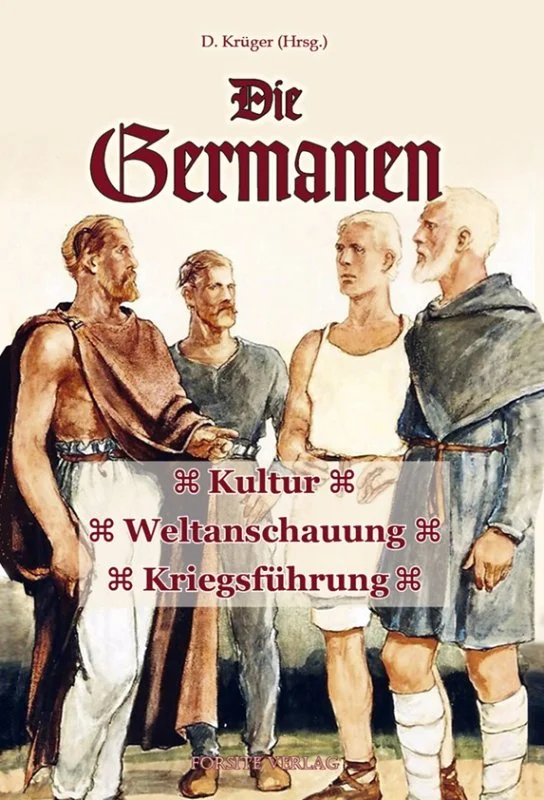Frank im Gespräch mit Sonnwill über die Wintersonnenwende und das Julfest
An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus Christus, so zumindest lautet das gängige Narrativ. Tatsächlich hat dieses Fest zu Ehren der Sonne seine Wurzeln nicht im Orient, sondern in den Breitengraden der Germanen. Sonnwill ist Archäologin und Kulturwissenschaftlerin. In diesem Interview mit Frank Kraemer spricht sie über die Wintersonnenwende, das Julfest und die heidnischen Wurzeln dieser Sonnen- und Lichtfeste.
Sonnwill ist Archäologin und Kulturwissenschaftlerin. In diesem Interview mit Frank Kraemer spricht sie über die Wintersonnenwende, das Julfest und die heidnischen Wurzeln dieser Sonnen- und Lichtfeste.
Frank: Sonnwill, das Julfest wird oft mit der Wintersonnenwende in Verbindung gebracht. Kannst Du uns kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Sonnwill: Sehr gern. Die Wintersonnenwende findet in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember statt. Das ist die längste Nacht des Jahres, die Sonne steht am niedrigsten Punkt. Danach werden die Tage wieder länger.
Frank Kraemer: Warum war dieses Fest für unsere Vorfahren so wichtig?
Sonnwill: Es galt als das wichtigste Fest des Jahres, da man die Wiedergeburt der Sonne feierte. Das Licht hatte eine enorme symbolische Bedeutung, weil die langen Winter dunkel und beschwerlich waren. Deshalb wurde die Wintersonnenwende als Wendepunkt und Neubeginn zelebriert.
Frank Kraemer: Oft hört man, dass das Julfest der „Vorläufer von Weihnachten“ sei. Stimmt das so?
Sonnwill: Zumindest in Teilen. Das Julfest galt bei Germanen und Kelten als wichtigstes Fest im Jahr, weil es die „Geburt der Sonne“ markierte. Mit der Christianisierung wurden viele Bräuche verboten, aber gleichzeitig auch umgedeutet. So wurde die Wintersonnenwende zum Geburtstag von Jesus erklärt.
Frank Kraemer: Wie haben die Christen auf die heidnischen Bräuche reagiert?
Sonnwill: Karl der Große etwa verbot diese Feste. In seinen Kapitularien steht, dass Opfer nach heidnischem Brauch mit hohen Strafen oder sogar dem Tod geahndet wurden. Trotzdem hielten sich viele Bräuche hartnäckig. Daher deutete die Kirche sie einfach um: Aus dem Julfest wurde Weihnachten, die Geburt von Jesus.
Frank Kraemer: Das heißt, Weihnachten wurde absichtlich auf diesen Zeitraum gelegt?
Sonnwill: Genau. Seit dem 4. Jahrhundert feiern Christen am 25. Dezember Weihnachten. Vermutlich wurde dieses Datum gewählt, weil es mit dem römischen Fest des Sonnengottes Mithras zusammenfiel, das im Volk sehr beliebt war.
Frank: Und warum feiern wir heute schon am 24. Dezember Heilig Abend?
Sonnwill: Das hängt mit einer älteren Zeitrechnung zusammen. Früher begann der neue Tag nicht um Mitternacht, sondern mit der Dämmerung. Deshalb war der 24. Dezember der Vorabend des eigentlichen Festes.
Frank Kraemer: Welche alten Bräuche sind uns denn heute noch erhalten geblieben?
Sonnwill: Ich denke da an den geschmückten Weihnachtsbaum, die Kerzen am Adventskranz oder die sogenannten Rauhnächte.
Frank Kraemer: Welche Rolle spielten die Rauhnächte?
Sonnwill: Die Rauhnächte dauern vom 25. Dezember bis 6. Januar. Sie galten als eine geheimnisvolle Zeit, in der Geister und Gestalten wie Frau Perchta oder die Wilde Jagd unterwegs waren. Frau Perchta prüfte, wer fleißig oder faul gewesen war. Es war üblich, in dieser Zeit keine lauten Arbeiten zu verrichten und keine Wäsche zu waschen. Man räucherte die Häuser aus, um böse Einflüsse fernzuhalten.
Frank Kraemer: Was hat es mit der Wilden Jagd auf sich?
Sonnwill: Man glaubte, dass Wodan, begleitet von Frau Holle oder Perchta, ein Heer aus den Seelen der Verstorbenen durch die Lüfte führte. Es war gefährlich, dieses Totenheer zu beobachten, da man mitgerissen werden konnte. Um sich zu schützen, opferte man Essensreste – Brot, Bohnen, Grütze oder Schnaps – vor der Tür oder im Garten.
Frank Kraemer: Und wie sieht es in Skandinavien aus, gibt es dort noch Spuren des Julfestes?
Sonnwill: Ja, dort heißt Weihnachten bis heute „Jul“, und man wünscht sich „God Jul“. Typisch ist der Julbock aus Stroh, der früher böse Geister vertreiben sollte und heute Geschenke trägt. Es gibt auch den Brauch des Julklotzes – ein großer Holzstamm, der während der zwölf Rauhnächte brannte. Seine Asche galt als segensreich und wurde auf Felder gestreut.
Frank Kraemer: Gibt es schriftliche Quellen, die das Julfest belegen?
Sonnwill: Nur wenige. Am wichtigsten sind altnordische Texte wie die Sagas, die der isländische Gelehrte Snorri Sturluson im 13. Jahrhundert aufzeichnete. In der Heimskringla beschreibt er Jul als ein großes Festmahl. Die Hákonar saga goða berichtet, dass König Håkon festlegte, das Julfest solle künftig mit Weihnachten zusammenfallen. In der Skaldendichtung ‚Haraldskvæði‘ wird Jul sogar noch in heidnischer Zeit erwähnt – dort spricht man vom ‚Jultrinken‘ und den Spielen des Gottes Freyr.
Frank Kraemer: Was bedeutet das Wort ‚Jul‘ eigentlich?
Sonnwill: Die Deutungen sind vielfältig. Manche sehen darin schlicht ein ‚Festmahl‘ oder ‚Gelage‘. Andere bringen es mit der Sonne oder dem Sonnenrad in Verbindung. Interessant ist, dass Odin auch den Beinamen ‚Jolnir‘ trägt, was eine Verbindung zwischen Gottheit und Fest andeutet.
Frank Kraemer: Also wissen wir gar nicht genau, wie das Julfest aussah?
Sonnwill: Richtig. Die Quellenlage ist spärlich. Wir können nur Bruchstücke rekonstruieren. Aber die symbolische Bedeutung des Festes – Licht, Wiedergeburt und Neubeginn – bleibt deutlich.
Frank Kraemer: Letzte Frage: Brauchen wir historische Quellen, um das Julfest heute feiern zu können?
Sonnwill: Meiner Meinung nach nicht. Vieles lebt im kollektiven Gedächtnis und in volkstümlichen Bräuchen weiter. Auch wenn die Quellenlage dünn ist, können wir uns der symbolischen Kraft der Wintersonnenwende bewusst werden – als Fest des Lichts, des Neubeginns und der geweihten Nächte und uns intuitiv wieder dem annähern, was in unserem Blut ist.
Wie man das Julfest gestalten kann, dazu habe ich ein paar Bildimpressionen aus den vergangenen Jahren mitgebracht. Ich wünsche allen eine friedliche, entspannte und erkenntnisreiche Winterzeit 2025-2026!